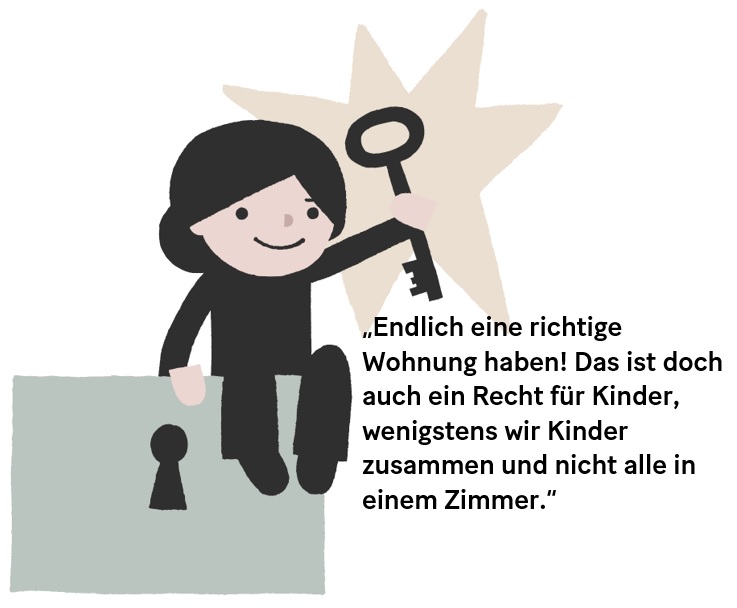In Artikel 28 der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen erkennen die Vertragsstaaten das Recht des Kindes auf Bildung an. Zur Verwirklichung dieses Rechts ist insbesondere eine verpflichtende und gebührenfreie Grundschulbildung vorgesehen. Auch weiterführende allgemeine wie berufsbildende Schulen sollen „verfügbar“ und „zugänglich“ sein. Der Zugang zu Hochschulen soll mit „allen geeigneten Mitteln“ ermöglicht werden. Auf den ersten Blick scheint das Recht auf Bildung in Deutschland verwirklicht, besuchen doch grundsätzlich alle Kinder eine gebührenfreie Grundschule und der Zugang zu weiterführender Bildung und zur Hochschulbildung ist durchaus gegeben. So besucht ein immer größerer Anteil der jungen Menschen eine weiterführende Schule der Sekundarstufe II. Auch die Zahl der Studierenden ist inzwischen deutlich höher als noch vor einigen Jahrzehnten.
Doch spätestens seitdem Vernor Muñoz, der damalige Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für das Recht auf Bildung, 2007 seinen Bericht zu Deutschland vorgelegt hat, steht die Frage im Raum, ob das Recht auf Bildung tatsächlich umfassend garantiert wird. Muñoz hatte Deutschland zuvor über zehn Tage bereist und mit zahlreichen Expertinnen und Experten gesprochen. Er wies in seinem Bericht nicht zuletzt auf Probleme im Zusammenhang mit dem Bildungsföderalismus hin und kritisierte insbesondere, dass das gegliederte deutsche Schulsystem offensichtlich zu einer massiven Ungleichverteilung der Bildungschancen beiträgt.
Ein Blick auf Artikel 29 der Kinderrechtskonvention zeigt, dass das Recht auf Bildung tatsächlich sehr viel mehr qualitative Dimensionen umfasst als den bloßen Zugang zu den verschiedenen Bildungsgängen. So muss Bildung darauf gerichtet sein, „die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes voll zur Entfaltung zu bringen“. Darüber hinaus ist „das Kind auf ein verantwortungsbewusstes Leben in einer freien Gesellschaft im Geist der Verständigung, des Friedens, der Toleranz, der Gleichberechtigung der Geschlechter und der Freundschaft zwischen allen Völkern und ethnischen, nationalen und religiösen Gruppen (…) vorzubereiten“. Wer diesen Auftrag der Kinderrechtskonvention ernst nimmt, kann die Augen vor vielen Mängeln des deutschen Bildungssystems nicht verschließen. Dies gilt in unterschiedlichen Ausprägungen für alle Bundesländer und für alle Bildungsbereiche, von der Kita bis zur Hochschule und der Weiterbildung.
Hier soll anhand von drei Problemen am Beispiel des hessischen Schulsystems aufgezeigt werden, warum die hohen Anforderungen der Kinderrechtskonvention als nicht umfassend erfüllt gelten müssen:
Erstens. An der bereits von Muñoz in den Mittelpunkt gestellten Chancenungleichheit hat sich bis 2020 leider nichts geändert. So zeigt beispielsweise der aktuelle Nationale Bildungsbericht auf, dass der Anteil der Schülerinnen und Schüler, der die Schule ohne Abschluss verlässt, in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen ist. So haben 2018 rund 53.600 jungen Menschen – ein Anteil von 6,8 Prozent – die Schule ohne Hauptschulabschluss verlassen. Die Voraussetzungen für die weitere Bildungs- und Berufsbiographie sind ohne Abschluss denkbar schlecht. Die aktuelle PISA-Untersuchung der OECD wiederum legt dar, dass der Bildungserfolg in Deutschland sehr viel enger an den sozialen Hintergrund geknüpft ist als in anderen Ländern: Beispielsweise erzielen hierzulande die Schülerinnen und Schüler mit günstigem sozioökonomischem Hintergrund bezüglich der Lesekompetenz im Schnitt 113 Punkte mehr als die sozioökonomisch benachteiligten Schülerinnen und Schüler. Damit war der Abstand zwischen diesen beiden Gruppen nicht nur größer als im Durchschnitt der OECD-Länder (89 Punkte), die Differenz ist gegenüber der Erhebung im Jahr 2009 sogar noch weiter angewachsen. Aus dem bundesweiten Bildungsmonitoring im Rahmen des IQB-Bildungstrends lässt sich entnehmen, dass die Chancenungleichheit in Hessen nochmal stärker ausgeprägt ist als in den meisten anderen Bundesländern.
Zweitens. Das Recht auf Bildung bezieht sich selbstverständlich auf alle Kinder, die sich im jeweiligen Land aufhalten. Die Schulpflicht in Hessen greift aber für Geflüchtete erst nach der Zuweisung zu einer Gebietskörperschaft. Das bedeutet, dass Kinder und Jugendliche für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten – so lange ist die Aufenthaltszeit in einer Erstaufnahmeeinrichtung bei einer „schlechten Bleibeperspektive“ – faktisch von schulischer Bildung ausgeschlossen werden. Andere Bundesländer wie Hamburg hingegen ermöglichen den Schulbesuch von Anfang an. Aber auch die Qualität des Bildungsangebots im Rahmen der so genannten „Intensivklassen“ für Schülerinnen und Schüler mit keinen oder geringen Deutschkenntnissen lässt zu wünschen übrig. Hier schlagen zu große Lerngruppen, eine zu geringe Stundenzuweisung sowie ein Mangel an entsprechend ausgebildeten Lehrkräften zu Buche. Darüber hinaus ist eine systematische und durchgehende sprachliche Bildung, bei der auch die Kompetenzen in der Herkunftssprache gefördert werden, bislang nicht an den hessischen Schulen verankert.
Drittens. Deutschland ist weltweit eines der wenigen westlichen Länder, das auch Minderjährige für den Militärdienst rekrutiert. Indem sich Deutschland dabei auf eine weiche Formulierung in der Kinderrechtskonvention (Artikel 38) beruft, unterläuft es letztendlich auch den oben widergegebenen Auftrag zur Friedensbildung aus Artikel 29, denn die Bundeswehr tritt inzwischen verstärkt an Schulen auf. Dort wirbt sie direkt oder indirekt für den Militärdienst, auch damit sie weiterhin 17-Jährige rekrutieren kann. Das Hessische Kultusministerium hat dazu eine Kooperationsvereinbarung mit der Bundeswehr abgeschlossen, die Jugendoffizieren den Zugang zum Unterricht ermöglicht.
Aus diesen Befunden lässt sich ein dringender Handlungsauftrag für die volle Verwirklichung des Rechts auf Bildung in Hessen ableiten, für gute Bildung für alle und für Friedensbildung. Auch der menschenrechtliche Auftrag für eine Umsetzung des Rechts auf inklusive Bildung aus der 2009 in Kraft getretenen UN-Behindertenrechtskonvention muss als noch nicht eingelöst gelten. Diesen Aufgaben muss sich die Bildungspolitik stellen, aber auch die Zivilgesellschaft ist gefordert – also wir alle.